 MT Melsungen -- Michael Allendorf, Ex-Nationalapieler, Europameister, Vize-Weltmeister, heute Sportvorstand des Handball-Bundesligisten MT Melsungen
MT Melsungen -- Michael Allendorf, Ex-Nationalapieler, Europameister, Vize-Weltmeister, heute Sportvorstand des Handball-Bundesligisten MT Melsungen
„Glückwunsch und Respekt, Dänemark. Aber: Wir müssen umdenken.“
Im WM-Fazit geht es nicht nur um die Erfolgsformel(n) der Dänen, sondern um etliche Probleme des globalen Handballs, die auch der Glanz von Gidsel & Co nicht überstrahlen kann.
Liebe Leserinnen und Leser,
die gerade beendete WM hat ihren verdienten wie auch erwarteten Sieger: Dänemark hat zum vierten Mal in Folge den Titel gewonnen. Kroatien hat im Finale von Oslo alles gegeben, sich trotz einiger Ausfälle wacker geschlagen und in manchen Phasen mitgehalten, konnte letztlich aber wie alle anderen Gegner der Dänen bei diesen Weltspielen doch nur Spalier stehen. Hut ab an dieser Stelle übrigens vor der Nationalmannschaftskarriere Domagoj Duvniaks, die am Sonntag in Oslo mit Silber endete. Die Überlegenheit des Teams von Nicolaj Jacobsen indes war wirklich erdrückend während dieser letzten zwei Wochen.
Der riesige Fundus an Topspielern – ich bin mir mit vielen anderen Beobachtern und Experten darin einig, dass Dänemark locker auch noch ein zweites Team zur WM hätte schicken können, das um die Medaillen spielt – ist beeindruckend. Selbst ohne die legendären Mikkel Hansen und Niklas Landin. Es fällt bei der Analyse auch auf, dass Jacobsen selten auf die Tiefe seines Kaders zurückgreift, sondern bevorzugt auf einen harten Kern setzt – und diesen nahezu durchspielen lässt.
Anders als wir konnten sich die Dänen dies aber auch leisten, da ihre Vielspieler nahezu keine Ermüdungserscheinungen zeigten. Paradebeispiel: Mathias Gidsel, derzeit sicher der beste Offensivspieler der Welt. Seine Ausdauer, Energie, Geschmeidigkeit und der nie enden wollende Tordrang machten ihn zum logischen MVP dieser WM.
Warum unser Nachbarland, nunmehr Abonnement-Weltmeister seit 2019 und Olympiasieger 2024, so viele Erfolge feiert und über eine nahezu unerschöpfliche Auswahl an immer wieder neuen Talenten verfügt, hat viele Gründe. Strukturelle wie kulturelle. Die dänische Liga ist mittlerweile so stark, dass nicht mehr alle Spieler ins Ausland wechseln müssen, um Weltklasse-Status zu erreichen. Juri Knorr wechselt nächste Saison sogar dorthin.
Trotzdem profitiert Dänemark natürlich davon, dass traditionell und aktuell viele ihrer Topstars im Ausland aktiv sind – bevorzugt bei Spitzenklubs in der als stärkste Liga der Welt eingestuften Bundesliga, vor allem in Flensburg, aber auch in Berlin oder Magdeburg. Die Spielfreude der Dänen, ihr Tempo und ihre Ballfertigkeit – die Nicolaj Jacobsen beinahe fanatisch mit dieser erkennbaren Siegermentalität und einem ansteckenden Teamspirit angereichert hat – sind kein Zufallsprodukt.
Diese Attribute haben auch damit zu tun, wie Handball in der Gesellschaft verankert ist, welche Akzeptanz und Bedeutung Sport und spielerische Nachwuchsarbeit dort haben – ohne komplizierte oder gar hinderliche Bürokratismen. Dass Kids überall im Land durch offene Türen gehen, wenn sie in einer Turnhalle üben und spielen wollen, hat sich ja bereits herumgesprochen. Umstände, von denen wir nur träumen können.
Mit Blick auf das deutsche Ausscheiden im Viertelfinale gegen Portugal flammten – jedenfalls temporär – natürlich wieder die Diskussionen rund um die Systematik hierzulande auf, wenn auch nicht mehr so grundsätzlich angesichts unserer Zukunftshoffnungen namens Uscins, Köster, Knorr, Fischer, Späth und Co. Vergleiche mit anderen Nationen haben immer Konjunktur, wenn der erhoffte Erfolg ausbleibt. Zur Fehlerbenennung gehören die Ursachenforschung und seriöse Vorschläge, es besser zu machen. Und das richtige Maß herauszufinden: Wird etwa zu viel hineininterpretiert? Denn natürlich geht es auch darum, einzuordnen, ob ein Tor, ein Schiedsrichterpfiff, eine Sekunde oder ein Schritt wirklich immer gleich eine fundamentale Krise bedeuten und Grundsatzdiskussionen hervorrufen müssen. Ob Verletzungen eine Rolle gespielt haben für das Abschneiden und wie stark das Belastungsproblem Einfluss nimmt.
Nuancen zu berücksichtigen gilt es auch bei der Beurteilung des jeweiligen Trainers – in unserem Fall Alfred Gislason, dessen Time-Outs und Coaching bei etlichen Insidern und Fachleuten kontrovers diskutiert wurden. Und, ja: Kritik und Ehrlichkeit dürfen grundsätzlich auch vor jemandem mit einem solch großen Namen nicht haltmachen. Ich schließe mich da durchaus mit ein, vor allem mit Blick auf das Timing und die Inhalte der deutschen Auszeiten. Allerdings gebietet es der Anstand, selbst das richtige Timing für solche Diskussionen zu wählen angesichts der Nachricht, dass Alfreds Vater während der WM verstorben ist. Insofern stehen hier Beileid und Rücksichtnahme klar über allem anderem.
Die Aufarbeitung – in welchem Umfang auch immer – und richtige Einordnung wird es dennoch geben, davon gehe ich aus. Alle Beteiligten sollten und werden Interesse daran haben. In einen Panik-Modus braucht hierzulande jedoch keiner verfallen, auch wenn unser Team hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist: Es gibt nachvollziehbare Erklärungen für die oberflächliche Diskrepanz zwischen Olympia-Silber und Platz sechs bei dieser WM. In meinen vorherigen Beiträgen zu diesem Turnier wurden diese ja auch bereits größtenteils benannt. Schlussfolgerungen sollten nicht plakativ sein, sondern substanziell.
Was mich zu einem weiteren Punkt bringt: Die – berechtigte – Kritik am Turniermodus, sprich an der Verteilung der WM auf drei Länder, besonders mit Blick auf die weiten Entfernungen zwischen den skandinavischen Gastgeberländern Dänemark und Norwegen einerseits und Kroatien andererseits. Dass WM- und EM-Turniere auf Nachbarländer verteilt werden, hat sich ja inzwischen durchgesetzt, da ein solches Mammut-Event infrastrukturell inzwischen nur noch in wenigen Ländern ausgerichtet werden kann. Ein Turnier aber derart zu zerstückeln sollte keine Dauerlösung sein. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Atmosphäre und natürlich auch um unnötige Zusatzbelastungen für die ohnehin schon geschlauchten Aktiven.
Die Debatte um die zunehmende Monokultur und die ausbleibende Globalisierung des Handballs, die Warnungen und Kritik an der bevorstehenden Anhäufung der großen Events in Deutschland, ist ebenso berechtigt. Die Dachverbände müssen sich diesen Themen stellen. Gegenmaßnahmen sind wichtig. Es bahnen sich ja auch einige Konjunkturprogramme und Entwicklungshilfen für den Handball an, mit Blick auf die USA und Asien. Sie bedürfen aber viel Ausdauer und Energie. Und natürlich kommt es darauf an, inwieweit wirtschaftliche Investitionen wirklich erwogen und dann auch generiert werden (können), um unseren Sport globaler präsentieren und etablieren zu können. Scheingefechte bringen uns nichts. Eine Olympia-Verbannung wäre tatsächlich eine Katastrophe für unsere Sportart.
Fortwährende Parolen – selbst wenn sie im Kern meine Zustimmung haben – und Alibi-Aktivismus als Reaktion darauf werden nicht ausreichen. Es geht um seriöse, nachhaltige Lösungen. Und zunächst um die Bereitschaft dazu. In meinen Augen ist bei aller Notwendigkeit einer regelmäßigen Präsenz des Handballs ein Ende der inflationären Ausrichtung von WM- und EM-Turnieren, alle zwei Jahre, einer der dringendsten Ansätze.
Jeder Titel an sich verliert an Wertigkeit in diesem Rhythmus, jedes Turnier wird nicht nur von den Aktiven, sondern auf deren Rücken ausgetragen. Hier sehe ich Handlungsbedarf. Weniger ist manchmal mehr. Insbesondere in einer Olympiasaison. Übersättigung und Überbelastung sind keine guten Marketingtools, keine Werbung für den Handball. Ich fühle mich in allen Prognosen aus meiner WM-Vorschau bestätigt: Das Niveau war abgesehen von einigen Highlights und der Dänemark-Show nicht besonders hoch, aus entsprechend logischen Gründen. Und genauso logisch war die hohe Anzahl an Verletzungen und Ausfällen, die ich auch befürchtet hatte.
Die internationalen Organisationen und auch der DHB als Vertreter unserer Interessen müssen sich endlich ernsthaft damit auseinandersetzen, ob eine andere Frequenz nicht viel zielführender ist. Denn die Hauptdarsteller – unsere Topstars – leiden darunter und zahlen dafür mit ihrer Gesundheit. Wenn, wie es im Falle von Mathias Gidsel scheint, nicht kurzfristig, so aber ganz sicher auf nicht allzu weite Sicht.
Im Kontext all dieser Punkte teile ich auch Warnungen, wie sie zum Beispiel mein Kollege Stefan Kretzschmar geäußert hat. Es ist nicht angebracht, dass wir uns in Deutschland die Hände reiben und auf die Schultern klopfen, weil eine Vielzahl der kommenden Titelkämpfe ganz oder teilweise hierzulande ausgetragen werden. Das ist tatsächlich viel zu kurz gedacht. Mir ist auch klar, dass es einfacher ist, Missstände aufzuzeigen als sie zu beseitigen. Aber es gibt ja interessante Vorschläge, die man einem Realitätscheck unterziehen sollte. Sehr bald, nicht erst irgendwann in der Zukunft.
Mir bleibt festzuhalten, dass ich ‚trotzdem‘ wieder viel Spaß hatte, meine Gedanken und Beobachtungen mit Euch und Ihnen zu teilen bei dieser WM. Ich hoffe, der Blick durch ‚meine Brille‘ hat hier und da neue Perspektiven eröffnet.
Bis bald,
Michael Allendorf
Michael Allendorf, Jahrgang 1986, spielte in der Bundesliga für die SG Wallau-Massenheim, die HSG Wetzlar sowie für MT Melsungen. Der Linksaußen kam auf insgesamt 493 Einsätze und erzielte 1.595 Tore. Für die A-Nationalmannschaft spielte er 17mal und warf 26 Tore. Seine größten Erfolge feierte der gebürtige Heppenheimer mit der A-Jugend Wallau-Massenheims (Deutscher Meister 2005) sowie als Junioren-Nationalspieler (Europameister 2006, Vize-Weltmeister 2007). In der letzten Saison seiner aktiven Laufbahn (2021/2022) schnupperte Allendorf bereits Manager-Luft als Assistent der Geschäftsleitung. Danach wechselte er komplett auf die Manager-Seite. Inzwischen verantwortet er als Sport-Vorstand der MT den Bundesligabereich der Nordhessen.
die gerade beendete WM hat ihren verdienten wie auch erwarteten Sieger: Dänemark hat zum vierten Mal in Folge den Titel gewonnen. Kroatien hat im Finale von Oslo alles gegeben, sich trotz einiger Ausfälle wacker geschlagen und in manchen Phasen mitgehalten, konnte letztlich aber wie alle anderen Gegner der Dänen bei diesen Weltspielen doch nur Spalier stehen. Hut ab an dieser Stelle übrigens vor der Nationalmannschaftskarriere Domagoj Duvniaks, die am Sonntag in Oslo mit Silber endete. Die Überlegenheit des Teams von Nicolaj Jacobsen indes war wirklich erdrückend während dieser letzten zwei Wochen.
Der riesige Fundus an Topspielern – ich bin mir mit vielen anderen Beobachtern und Experten darin einig, dass Dänemark locker auch noch ein zweites Team zur WM hätte schicken können, das um die Medaillen spielt – ist beeindruckend. Selbst ohne die legendären Mikkel Hansen und Niklas Landin. Es fällt bei der Analyse auch auf, dass Jacobsen selten auf die Tiefe seines Kaders zurückgreift, sondern bevorzugt auf einen harten Kern setzt – und diesen nahezu durchspielen lässt.
Anders als wir konnten sich die Dänen dies aber auch leisten, da ihre Vielspieler nahezu keine Ermüdungserscheinungen zeigten. Paradebeispiel: Mathias Gidsel, derzeit sicher der beste Offensivspieler der Welt. Seine Ausdauer, Energie, Geschmeidigkeit und der nie enden wollende Tordrang machten ihn zum logischen MVP dieser WM.
Warum unser Nachbarland, nunmehr Abonnement-Weltmeister seit 2019 und Olympiasieger 2024, so viele Erfolge feiert und über eine nahezu unerschöpfliche Auswahl an immer wieder neuen Talenten verfügt, hat viele Gründe. Strukturelle wie kulturelle. Die dänische Liga ist mittlerweile so stark, dass nicht mehr alle Spieler ins Ausland wechseln müssen, um Weltklasse-Status zu erreichen. Juri Knorr wechselt nächste Saison sogar dorthin.
Trotzdem profitiert Dänemark natürlich davon, dass traditionell und aktuell viele ihrer Topstars im Ausland aktiv sind – bevorzugt bei Spitzenklubs in der als stärkste Liga der Welt eingestuften Bundesliga, vor allem in Flensburg, aber auch in Berlin oder Magdeburg. Die Spielfreude der Dänen, ihr Tempo und ihre Ballfertigkeit – die Nicolaj Jacobsen beinahe fanatisch mit dieser erkennbaren Siegermentalität und einem ansteckenden Teamspirit angereichert hat – sind kein Zufallsprodukt.
Diese Attribute haben auch damit zu tun, wie Handball in der Gesellschaft verankert ist, welche Akzeptanz und Bedeutung Sport und spielerische Nachwuchsarbeit dort haben – ohne komplizierte oder gar hinderliche Bürokratismen. Dass Kids überall im Land durch offene Türen gehen, wenn sie in einer Turnhalle üben und spielen wollen, hat sich ja bereits herumgesprochen. Umstände, von denen wir nur träumen können.
Mit Blick auf das deutsche Ausscheiden im Viertelfinale gegen Portugal flammten – jedenfalls temporär – natürlich wieder die Diskussionen rund um die Systematik hierzulande auf, wenn auch nicht mehr so grundsätzlich angesichts unserer Zukunftshoffnungen namens Uscins, Köster, Knorr, Fischer, Späth und Co. Vergleiche mit anderen Nationen haben immer Konjunktur, wenn der erhoffte Erfolg ausbleibt. Zur Fehlerbenennung gehören die Ursachenforschung und seriöse Vorschläge, es besser zu machen. Und das richtige Maß herauszufinden: Wird etwa zu viel hineininterpretiert? Denn natürlich geht es auch darum, einzuordnen, ob ein Tor, ein Schiedsrichterpfiff, eine Sekunde oder ein Schritt wirklich immer gleich eine fundamentale Krise bedeuten und Grundsatzdiskussionen hervorrufen müssen. Ob Verletzungen eine Rolle gespielt haben für das Abschneiden und wie stark das Belastungsproblem Einfluss nimmt.
Nuancen zu berücksichtigen gilt es auch bei der Beurteilung des jeweiligen Trainers – in unserem Fall Alfred Gislason, dessen Time-Outs und Coaching bei etlichen Insidern und Fachleuten kontrovers diskutiert wurden. Und, ja: Kritik und Ehrlichkeit dürfen grundsätzlich auch vor jemandem mit einem solch großen Namen nicht haltmachen. Ich schließe mich da durchaus mit ein, vor allem mit Blick auf das Timing und die Inhalte der deutschen Auszeiten. Allerdings gebietet es der Anstand, selbst das richtige Timing für solche Diskussionen zu wählen angesichts der Nachricht, dass Alfreds Vater während der WM verstorben ist. Insofern stehen hier Beileid und Rücksichtnahme klar über allem anderem.
Die Aufarbeitung – in welchem Umfang auch immer – und richtige Einordnung wird es dennoch geben, davon gehe ich aus. Alle Beteiligten sollten und werden Interesse daran haben. In einen Panik-Modus braucht hierzulande jedoch keiner verfallen, auch wenn unser Team hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist: Es gibt nachvollziehbare Erklärungen für die oberflächliche Diskrepanz zwischen Olympia-Silber und Platz sechs bei dieser WM. In meinen vorherigen Beiträgen zu diesem Turnier wurden diese ja auch bereits größtenteils benannt. Schlussfolgerungen sollten nicht plakativ sein, sondern substanziell.
Was mich zu einem weiteren Punkt bringt: Die – berechtigte – Kritik am Turniermodus, sprich an der Verteilung der WM auf drei Länder, besonders mit Blick auf die weiten Entfernungen zwischen den skandinavischen Gastgeberländern Dänemark und Norwegen einerseits und Kroatien andererseits. Dass WM- und EM-Turniere auf Nachbarländer verteilt werden, hat sich ja inzwischen durchgesetzt, da ein solches Mammut-Event infrastrukturell inzwischen nur noch in wenigen Ländern ausgerichtet werden kann. Ein Turnier aber derart zu zerstückeln sollte keine Dauerlösung sein. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Atmosphäre und natürlich auch um unnötige Zusatzbelastungen für die ohnehin schon geschlauchten Aktiven.
Die Debatte um die zunehmende Monokultur und die ausbleibende Globalisierung des Handballs, die Warnungen und Kritik an der bevorstehenden Anhäufung der großen Events in Deutschland, ist ebenso berechtigt. Die Dachverbände müssen sich diesen Themen stellen. Gegenmaßnahmen sind wichtig. Es bahnen sich ja auch einige Konjunkturprogramme und Entwicklungshilfen für den Handball an, mit Blick auf die USA und Asien. Sie bedürfen aber viel Ausdauer und Energie. Und natürlich kommt es darauf an, inwieweit wirtschaftliche Investitionen wirklich erwogen und dann auch generiert werden (können), um unseren Sport globaler präsentieren und etablieren zu können. Scheingefechte bringen uns nichts. Eine Olympia-Verbannung wäre tatsächlich eine Katastrophe für unsere Sportart.
Fortwährende Parolen – selbst wenn sie im Kern meine Zustimmung haben – und Alibi-Aktivismus als Reaktion darauf werden nicht ausreichen. Es geht um seriöse, nachhaltige Lösungen. Und zunächst um die Bereitschaft dazu. In meinen Augen ist bei aller Notwendigkeit einer regelmäßigen Präsenz des Handballs ein Ende der inflationären Ausrichtung von WM- und EM-Turnieren, alle zwei Jahre, einer der dringendsten Ansätze.
Jeder Titel an sich verliert an Wertigkeit in diesem Rhythmus, jedes Turnier wird nicht nur von den Aktiven, sondern auf deren Rücken ausgetragen. Hier sehe ich Handlungsbedarf. Weniger ist manchmal mehr. Insbesondere in einer Olympiasaison. Übersättigung und Überbelastung sind keine guten Marketingtools, keine Werbung für den Handball. Ich fühle mich in allen Prognosen aus meiner WM-Vorschau bestätigt: Das Niveau war abgesehen von einigen Highlights und der Dänemark-Show nicht besonders hoch, aus entsprechend logischen Gründen. Und genauso logisch war die hohe Anzahl an Verletzungen und Ausfällen, die ich auch befürchtet hatte.
Die internationalen Organisationen und auch der DHB als Vertreter unserer Interessen müssen sich endlich ernsthaft damit auseinandersetzen, ob eine andere Frequenz nicht viel zielführender ist. Denn die Hauptdarsteller – unsere Topstars – leiden darunter und zahlen dafür mit ihrer Gesundheit. Wenn, wie es im Falle von Mathias Gidsel scheint, nicht kurzfristig, so aber ganz sicher auf nicht allzu weite Sicht.
Im Kontext all dieser Punkte teile ich auch Warnungen, wie sie zum Beispiel mein Kollege Stefan Kretzschmar geäußert hat. Es ist nicht angebracht, dass wir uns in Deutschland die Hände reiben und auf die Schultern klopfen, weil eine Vielzahl der kommenden Titelkämpfe ganz oder teilweise hierzulande ausgetragen werden. Das ist tatsächlich viel zu kurz gedacht. Mir ist auch klar, dass es einfacher ist, Missstände aufzuzeigen als sie zu beseitigen. Aber es gibt ja interessante Vorschläge, die man einem Realitätscheck unterziehen sollte. Sehr bald, nicht erst irgendwann in der Zukunft.
Mir bleibt festzuhalten, dass ich ‚trotzdem‘ wieder viel Spaß hatte, meine Gedanken und Beobachtungen mit Euch und Ihnen zu teilen bei dieser WM. Ich hoffe, der Blick durch ‚meine Brille‘ hat hier und da neue Perspektiven eröffnet.
Bis bald,
Michael Allendorf
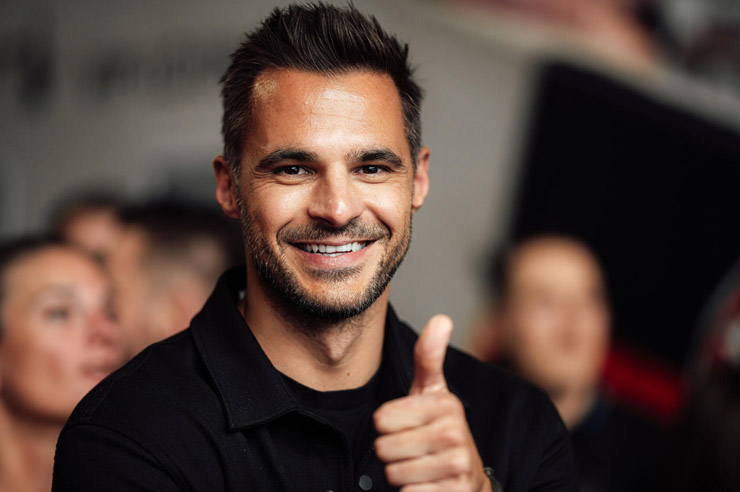
Zur Person: Michael Allendorf
Michael Allendorf, Jahrgang 1986, spielte in der Bundesliga für die SG Wallau-Massenheim, die HSG Wetzlar sowie für MT Melsungen. Der Linksaußen kam auf insgesamt 493 Einsätze und erzielte 1.595 Tore. Für die A-Nationalmannschaft spielte er 17mal und warf 26 Tore. Seine größten Erfolge feierte der gebürtige Heppenheimer mit der A-Jugend Wallau-Massenheims (Deutscher Meister 2005) sowie als Junioren-Nationalspieler (Europameister 2006, Vize-Weltmeister 2007). In der letzten Saison seiner aktiven Laufbahn (2021/2022) schnupperte Allendorf bereits Manager-Luft als Assistent der Geschäftsleitung. Danach wechselte er komplett auf die Manager-Seite. Inzwischen verantwortet er als Sport-Vorstand der MT den Bundesligabereich der Nordhessen. Weiterführende Informationen zum olympischen Handballturnier
Kolumne Teil 1: Brust raus, Nase nicht zu hoch
Kolumne Teil 2: „Pflicht Teil 1 erfüllt, Luft nach oben vorhanden“
Kolumne Teil 3: Fühle mich an Olympia erinnert – und das stimmt mich optimistisch
Kolumne Teil 2: „Pflicht Teil 1 erfüllt, Luft nach oben vorhanden“
Kolumne Teil 3: Fühle mich an Olympia erinnert – und das stimmt mich optimistisch






